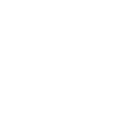Reportagen
Nachrichten
Die sarkastische Wahrheit
Weil die Realität einfach unerträglich ist, darum: Unabhängiger Journalismus
Reportagen

Gustl Mollath sitzt in seiner kleinen Wohnung in Nürnberg. Es ist ein verregneter Nachmittag im August 2003, und die Scheidung von seiner Frau Petra eskaliert.

Während einer Zugreise nach Berlin wurde ich Zeuge eines zutiefst bewegenden Moments, der mir die Zerbrechlichkeit des Lebens und die unerschütterliche Stärke einer jungen Mutter vor Augen führte

In einer Welt, in der der Mensch dem Zufall oft mit Sinn antwortet, gibt es Lebensgeschichten, die sich aller Wahrscheinlichkeit widersetzen – Geschichten, bei denen selbst der nüchternste Statistiker nervös den Taschenrechner einpackt. Eine solche Geschichte ist die von Violet Constance Jessop, geboren 1887, gestorben 1971 – Stewardess, Krankenschwester, und – was für ein Titel – dreifache Überlebende der bekanntesten Schiffsunglücke des 20. Jahrhunderts.